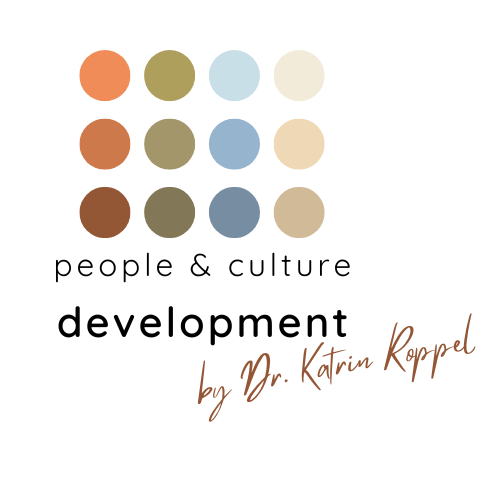28. JULI 2025
Psychologische Sicherheit als Fundament wirksamer Führung
Dr. Katrin Roppel

Warum psychologische Sicherheit zentral ist
Was passiert, wenn Führung zur Bühne für Machtspiele wird? Wenn nicht Zusammenarbeit zählt, sondern Selbstdarstellung? Wenn Teams sich nicht gegenseitig stärken – sondern bekämpfen?
Wenn in einer Organisation die Menschen mehr gegeneinander als miteinander arbeiten, wenn sich die Mitarbeiter nicht vertrauen, auch der Führung nicht vertrauen, ist das eine dysfunktionale Organisation.
Der Mangel an psychologischer Sicherheit lähmt Organisationen. Menschen verschweigen Ideen, vermeiden Rückfragen, vertuschen Fehler – aus Angst. Was folgt, ist ein Klima des Misstrauens, ein stiller Kampf um Einfluss, ein Ort, an dem Leistung nicht aufblüht, sondern erstickt.
Psychologische Sicherheit ist ein strategischer Hebel – still, aber mächtig. Wer führt, gestaltet Räume. Die Frage lautet: Gestalten wir Räume, in denen Menschen aufblühen? Oder solche, in denen sie verstummen?
Was ist psychologische Sicherheit?
Psychologische Sicherheit beschreibt das Gefühl, in einem sozialen Kontext – etwa in einem Team – frei sprechen, Fragen stellen und Fehler zugeben zu können, ohne Angst vor Abwertung oder Sanktionen.
Amy Edmondson, Harvard-Professorin, definierte den Begriff in den 1990er-Jahren als „die Überzeugung, dass niemand für das Äußern seiner Gedanken oder das Eingestehen von Fehlern bestraft oder bloßgestellt wird.“
Es geht nicht um Harmonie oder ein kollektives Schulterklopfen. Es geht darum, ob Menschen sich trauen, authentisch zu sein – und ob Führung diesen Mut ermöglicht oder verhindert.
In Teams mit psychologischer Sicherheit werden Fehler reflektiert, Wissen geteilt und Ideen geäußert. Studien zeigen: Solche Teams sind leistungsfähiger, kreativer und resilienter.
Google erkannte in seinem Forschungsprojekt „Project Aristotle“ psychologische Sicherheit als wichtigsten Erfolgsfaktor für Teams – noch vor Intelligenz, Erfahrung oder Teamgröße.
Psychologische Sicherheit beginnt mit Führung
Psychologische Sicherheit fällt nicht vom Himmel – sie wird gestaltet. Wie Führungskräfte kommunizieren, zuhören, mit Fehlern umgehen und Feedback geben, bestimmt, ob ein Team angstfrei lernen und arbeiten kann.
Verhalten wie Dominanz, Abwertung von Meinungen oder Belohnung von Perfektion sendet eine klare Botschaft: Hier besser keine Fehler machen – und bloß keine neuen Gedanken äußern.
Dagegen fördern Führungskräfte Sicherheit, wenn sie:
- eigene Fehler offenlegen,
- aktiv um Meinungen bitten,
- konstruktives Feedback geben,
- und Fehler als Lernchance betrachten.
Psychologische Sicherheit heißt nicht, Führung weich zu machen. Klarheit, Konsequenz und Anspruch sind wichtig – verbunden mit einer Haltung, die ermutigt statt einschüchtert.
Sie ist damit eine Führungsaufgabe mit strategischer Wirkung: Sie entscheidet, ob Mitarbeitende sich einbringen oder innerlich kündigen – ob Transformation gelingt oder scheitert.
Was fehlt, wenn Sicherheit fehlt?
Wenn psychologische Sicherheit fehlt, wird nicht einfach nur weniger gesprochen – es wird weniger gedacht, gelernt und gewagt.
Ein Klima des Misstrauens breitet sich aus. Feedback bleibt aus, Innovation wird gebremst, Wissen zurückgehalten. Energie fließt in Selbstschutz statt in Zusammenarbeit. Fehler werden vertuscht, Verantwortung delegiert, klare Positionen gemieden. Führung reagiert nur noch, statt zu gestalten. Vertrauen schwindet, politische Spielchen gewinnen Raum. Menschen stimmen nur zum Schein zu, sichern sich ab, vermeiden alles Kritische. Kreativität erstickt, Gerüchte ersetzen echtes Vertrauen.
Psychologische Sicherheit wäre der Puffer – doch fehlt sie, steigt die Wahrscheinlichkeit für emotionale Erschöpfung, Zynismus und das Gefühl von Ineffektivität – die drei Kernsymptome von Burnout laut ICD-11. Besonders bitter: Die talentiertesten Köpfe ziehen sich innerlich zurück oder verlassen das Unternehmen – auf der Suche nach einem Ort, der ihnen Halt und Stimme gibt.
Psychologische Unsicherheit ist ein stiller Produktivitätskiller. Ihre Wirkung ist subtil, aber massiv. Und weil Schweigen nicht messbar ist, bleibt ihre Abwesenheit oft unbemerkt.
Googles „Project Aristotle“: Was macht Teams wirklich erfolgreich?
2012 startete Google eine groß angelegte Studie mit der Frage: Was unterscheidet erfolgreiche Teams von weniger erfolgreichen?
Das Ergebnis war überraschend: Es waren weder Intelligenz noch Erfahrung – sondern psychologische Sicherheit.
Google analysierte über 180 Teams und identifizierte fünf zentrale Faktoren für Team-Effektivität – mit psychologischer Sicherheit als wichtigstem:
- Psychologische Sicherheit: Teammitglieder trauen sich, Risiken einzugehen, Fragen zu stellen und Fehler zuzugeben – ohne Angst vor negativen Konsequenzen.
- Verlässlichkeit: Aufgaben werden zuverlässig und pünktlich erledigt.
- Struktur & Klarheit: Rollen, Ziele und Prozesse sind transparent.
- Sinn: Die Arbeit hat für die Einzelnen eine persönliche Bedeutung.
- Impact: Die Arbeit trägt sichtbar zum Erfolg des Teams oder der Organisation bei.
Teams mit Sicherheit zeigten mehr Innovation, Engagement und Stabilität – unabhängig von Talentniveau oder Erfahrung. Google entwickelte daraus Tools wie Surveys und Gesprächsleitfäden, um Sicherheit messbar und gestaltbar zu machen – ein Beispiel, wie Forschung Führung verändert.
Wirkung auf Organisation und Personalentwicklung
Psychologische Sicherheit ist der Boden, auf dem Entwicklung gedeiht. Sie ermöglicht Lernkultur, echte Transformation und wirkt direkt auf Engagement und Mitarbeiterbindung.
- Lernkultur & Feedback
Sichere Räume erlauben Fragen wie Wie hast du das gemacht? oder Aussagen wie Ich weiß es nicht. Fehler werden reflektiert, Feedback als Einladung gesehen. Führungskräfte, die Sicherheit schaffen, gestalten Lernklima – in dem Leistung nicht nur gefordert, sondern ermöglicht wird.
- Transformation & Agilität
Transformation bedeutet, Gewohntes zu hinterfragen. Dafür braucht es Menschen, die mutig, kritisch und kreativ agieren. Ohne psychologische Sicherheit bleibt jeder agile Prozess eine leere Methode – jede Change-Initiative eine Einladung zum Rückzug.
- Retention & Engagement
Wer sich sicher fühlt, bleibt. Wer sich gehört fühlt, bringt sich ein. In einer Arbeitswelt, die Talente umwirbt, zählt weniger die Benefit-Liste, sondern die gelebte Kultur. Psychologische Sicherheit erhöht Engagement, reduziert Fluktuation und macht Mitarbeitende zu Mitgestaltenden.
Impulse für Führungskräfte
Psychologische Sicherheit wird durch Führung gestaltet – durch Haltung und Verhalten. Offenheit beginnt bei der Führungskraft. Das bedeutet: präsent sein, zuhören, Konflikte nicht vermeiden, sondern konstruktiv begleiten.
Wenn Vertrauen den Raum füllt, wird Kontrolle nebensächlich. Führung, die Sicherheit ermöglicht, stellt Fragen wie: Was brauchst du gerade, um weiterzukommen? Sie schafft Bedingungen, unter denen Menschen wachsen können – nicht aus Pflicht, sondern aus Zutrauen.
Besonders sichtbar wird psychologische Sicherheit in der Fehlerkultur. Entscheidend ist nicht, ob Fehler passieren – sondern, wie darauf reagiert wird. Wird Mut belohnt, auch wenn ein Versuch scheitert? Werden Irrtümer genutzt, um gemeinsam zu lernen?
Dazu braucht es systematische Aufmerksamkeit: Reflexionsformate, Pulsbefragungen, regelmäßige Check-ins. Führung bedeutet, Räume zu schaffen, in denen auch das Nicht-Gesagte gefragt werden darf: Fühlen wir uns sicher? Was braucht unser Team, um sich zu zeigen?
Fazit: Sicherheit als strategische Führungsleistung
Psychologische Sicherheit ist kein abstraktes Konzept. Sie entscheidet, ob Menschen sich zeigen oder zurückziehen, ob Teams stagnieren oder wachsen.
Sie beginnt nicht mit einem Workshop. Sie beginnt mit einer Haltung. Vielleicht mit Ihrer?
Was passiert, wenn das stille Nicken zur Norm wird und gute Ideen gar nicht erst ausgesprochen werden?
Wie fehlende psychologische Sicherheit nicht nur Innovation erstickt, sondern auch Vertrauen, Motivation und Gesundheit untergräbt – und warum sie der entscheidende Hebel für echte Zusammenarbeit ist.
Seit 2012 helfe ich Menschen, beruflich klarzukommen – mit sich, mit anderen und mit der Rolle, die sie wirklich ausfüllen wollen.
Was mich auszeichnet: schnelles Erfassen, was schiefläuft – und ein Blick fürs Wesentliche. Kein Firlefanz, keine Buzzwords – einfach ehrliche, punktgenaue Begleitung. Ich bin gut im Zwischen-den-Zeilen-Lesen. Genau das hilft mir, Menschen auf Spur zu bringen – klarer zu denken, besser zu handeln, mit weniger Theater im Kopf. Lassen Sie uns sprechen - ohne Blabla, dafür mit Tiefgang!